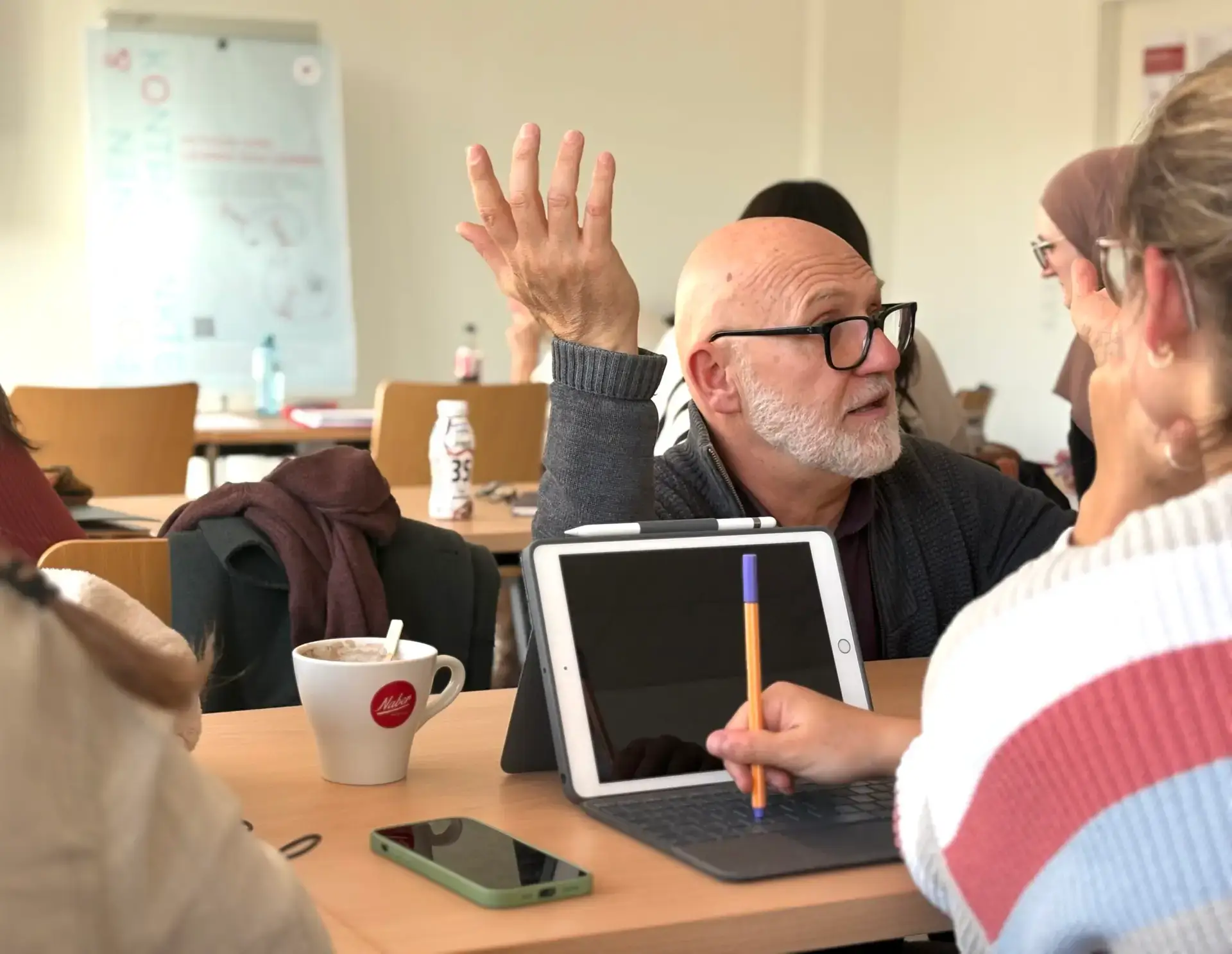
Was bedeutet es wirklich, wenn wir vom „Lehren zum Lernen“ übergehen?
Diese Frage steht im Zentrum der Auftaktveranstaltung unserer diskursiven Reihe im Wintersemester 2025/26. Anna Schopf und Peter Riegler durften zahlreiche Kolleg:innen und Studierende begrüßen – und einen Vortrag von Prof. Dr. Stephan Ellinger (Universität Würzburg) erleben, der zum Nachdenken anregt und zugleich herausfordert. Lernen war lange Zeit die Betriebsprämisse aller Maßnahmen des Erziehens (Prange 2005), es kann nicht hergestellt werden und ist nicht gut zu beobachten. Durch den Paradigmenwechsel hin zum Lernen in der Unterrichtsgestaltung hat dies Konsequenzen, die im Vortrag behandelt wurden.
🎓 Worauf aufmerksam gemacht werden kann:
Stephan Ellinger eröffnete die Veranstaltung mit einer kritischen Reflexion über den Paradigmenwechsel „Vom Lehren zum Lernen“ und dem Verlust der Pädagogik als Leitdisziplin im bildungswissenschaftlichen Diskurs, als auch für die Pädagog:innenbildung. Was auf den ersten Blick wie ein Fortschritt wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ambivalenter Mythos. Der Vortrag zeigte eindrucksvoll, dass dieser Wandel nicht automatisch zu mehr Inklusivität führt – im Gegenteil: Kinder, insbesondere bildungsbenachteiligte, erleben zunehmend Entfremdung in der Schule, das sich in individuellen Lernhemmnissen sichtbar macht.
Ellinger zeigte, dass es bei den Gefährdungslagen von Kindern mittlerweile einen Konsens über deren Auswirkungen auf Schulmisserfolg gibt. Er rief den Erziehungsauftrag in Erinnerung, der uns dabei helfen könnte Maßnahmen in den Blick zu nehmen, die zur Mündigkeit und Eigenständigkeit im Lernen des Edukanden beitragen können. Um die Entfremdung durch Schule und Unterricht aus den kindlichen Erfahrungswelten theoretisch einfangen zu können, griff er auf die Resonanztheorie (Hartmut Rosa) zurück. Die heutige Gesellschaft würde unter der ständigen Verfügbarkeit und Beschleunigung genau diese Erfahrungsschritte abkürzen und für Kinder unzugänglich machen. Die Folge: Abstumpfung und Entfremdung, auch im schulischen Kontext.
Aber genau hiervon bräuchte es mehr: Etwas bewegt oder begeistert uns, Wechselseitigkeit, Unverfügbarkeit, das alles macht Resonanzerleben aus – und hier schließt sich der Kreis zu den zentralen Elementen gelingender Bildungsprozesse in allen Lebenswelten. Doch nicht alle Lebenswelten haben eine Nähe zum Schulischen. So hat die Übung als solche auch eine milieubedingte Konnotation, Kinder aus Mittelschichtsfamilien wissen, was eine Übung ausmacht, lange bevor sie in die Schule kommen.
🏫 Was wir wissen: Schule als Ort der Reproduktion!
In der Diskussion wurde deutlich, dass die mittelschichtsbezogene Schule – insbesondere in der Migrationsgesellschaft – vor enormen Herausforderungen steht. Die Praxis verfügt oft nicht über die notwendigen Handlungsoptionen, um mit den komplexen Anforderungen umzugehen. Ungleichheiten werden nicht nur reproduziert, sondern teilweise sogar verstärkt. Daher war immer ein Strang von Schulkritik auch Elitenkritik.
Mit einem Verweis auf Roland Reichenbach lässt es sich auf den Punkt bringen: „Betreiben wir eine Pädagogik der Privilegierten in unseren Schulen?“ Und mit Jacques Rancière ergänzt: „Das Beibringen von Wissen ist ein Bringen von etwas Fremden und der Ruf zur Unterordnung.“ Diese Aussagen werfen die Frage auf, wie wir uns als Lehrpersonen verstehen: Als Wissensvermittler:innen oder als Ermöglicher:innen von Selbststeuerung und Resonanz?
🧭 Was wir wollen: Pädagogik als Leitdisziplin für das Erkennen von Lernhemmnissen und Lernmitteln?
Ellinger plädierte eindringlich dafür, die Pädagogik wieder ins Zentrum der Pädagog:innenbildung zu rücken und Pädagog:innen als Verantwortliche für Erziehung zu verstehen. Lernen als komplexer Erfahrungsprozess kann immer anhand von drei Dimensionen beschrieben werden: das Wollen, das Wissen und das Können. Das Problem – der Lernanreiz/die Bildungsgelegenheit kommt immer aus der (anderen) Welt – in der Schule ist zudem gegenständlich gerahmt. Lernhilfen orientieren sich oftmals am Gegenstand, statt an den Lernhemmnissen, die ebenso aus den drei Dimensionen kommen können. Eine besondere Bedeutung liegt auf dem Verstehen der Lebenswelten der Kinder, ihrer Zugänge, aber auch möglichen Lernhemmnissen. Nicht der Stoff, sondern die Kinder/Schüler:innen sollen im Mittelpunkt stehen, so die These Ellingers. Aber reicht Beziehung allein dafür aus? Als Inspirationsquelle nannte er Donata Elschenbroich und ihr Werk „Weltwissen der Siebenjährigen“, das eindrucksvoll zeigt, welche altersspezifischen Bildungsgelegenheiten wir Kinder auch zugänglich machen sollen, damit ihre Welterfahrungen vielfältig werden können.
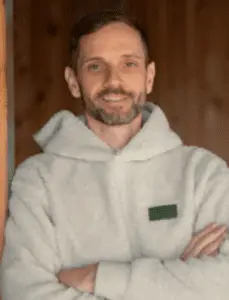
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Institute
Institute